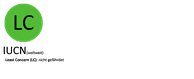Der Isabellsteinschmätzer (Oenanthe isabellina) ist in seinem Brutgebiet eng an das Vorkommen von Nagetierbauten gebunden. Er nutzt diese als Bruthöhlen. Die Bindung kann zu starken Populationsschwankungen führen, wenn Nagetierpopulationen reduziert oder sogar eliminiert werden.
Eingegriffen wird in die Bestände der Nagetiere in den asiatischen Steppen aus hygienischen Gründen. Die Große Renmaus (Rhombomys opimus) zum Beispiel ist ein Überträger der Pest. Pestausbrüche erfolgen regelmäßig zwei Jahre nach einem Maximum der Rennmausbestände im Zyklus der Populationsschwankung dieser Art. Zum Eindämmen der Pest werden deshalb die Bestände der Nagetiere reguliert. In Zuge solcher Maßnahmen kann es zu einem starken lokalen Rückgang des Isabellsteinschmätzers kommen.
Steckbrief
Größe: 16–17 cm
Gewicht: 21–39 g
Verbreitung: Südosteuropa bis Zentralasien (u. a. Mongolei, Kasachstan, Iran), Überwinterung in Afrika, Arabischer Halbinsel und Südasien
Nahrung: Insekten (v. a. Ameisen, Käfer, Termiten, Raupen), Spinnen, Tausendfüßer, kleine Wirbeltiere, gelegentlich Samen
Lebensraum: Trockene, offene Landschaften wie Halbwüsten, Steppen, Bergtäler, Geröllflächen, meist in der Nähe von Nagetierbauten
Zugverhalten: Langstreckenzieher; Zug im Herbst (v. a. August bis Oktober), Rückkehr ins Brutgebiet ab Februar–März
Brutzeit: Februar bis Juli (je nach Region)
Nest: Napf aus Gras, Wurzeln und Haaren, tief in Nagetierbauten (bis 3 m), seltener in natürlichen Höhlen
Fortpflanzung: Teilweise polygam; 4–7 Eier; Brutdauer: 12–15 Tage; Nestlingszeit: 13–17 Tage; flügge: nach 13–17 Tagen; Betreuung: ca. 14 Tage
Höchstalter: unbekannt
Bestand: 2,1–6,3 Mio. Brutpaare in Europa; 27,5-83,0 Millionen Vögel weltweit
Status: Nicht gefährdet (LC – Least Concern)
In Deutschland seltener Irrgast, zuletzt 2024 auf Helgoland
Stimme
Der Gesang des Isabellsteinschmätzers ist laut, reich und melodiös und wird überwiegend vom Männchen, gelegentlich aber auch vom Weibchen sowohl im Brutgebiet als auch im Winterquartier vorgetragen. Er besteht aus 3–7 Sekunden langen, variablen Phrasen mit Pfeif-, Scharr-, Schnarr- und „chack“-Lauten, häufig mit beeindruckenden Imitationen anderer Vogelarten und sogar untypischer Geräusche wie Hundewelpen oder Hirtenpfeifen. Der Fluggesang beginnt mit beschleunigten „chyup“-Lauten im Aufstieg und geht im Sinkflug in ein schnelles Durcheinander metallischer, knackender Laute über; daneben gehören zu den Rufen ein gepfiffenes „wiiu“, ein raues „chack“ sowie im Balzverhalten abgehackte Pfiffe und „kwot-kwot“-Laute.
Gesang
Rufe
Beobachtungen in Deutschland

Das Brutgebiet des Isabellsteinschmätzers erstreckt sich von Südosteuropa über die Halbwüsten und Steppengebiete des asiatischen Raums bis China. Er ist ein Langstreckenzieher, der von Afrika, südlich der Sahara, bis Indien überwintert. In Mitteleuropa ist die Art das erste Mal 1986 im Mai in Polen auf der Ostseehalbinsel Jastarnia nachgewiesen worden. Die Erstbeobachtung in Deutschland gelang im Herbst 1999 auf Helgoland. Seitdem ist der Isabellsteinschmätzer elfmal in Deutschland beobachtet worden, zehnmal im Herbst, sechsmal auf Helgoland. Zuletzt am 22. Oktober 2024 auf Helgoland.
Merkmale
Der Isabellsteinschmätzer wirkt insgesamt sandfarben und kontrastarm. Männchen im Brutkleid zeigen ein helles, beiges bis weißliches Gefieder mit kräftigem Überaugenstreif und einem oft gut sichtbaren dunklen Zügelstreif. Im Schlichtkleid sind Oberseite und Unterseite heller und durch helle Federsäume weniger kontrastreich, der Zügelstreif ist nur noch undeutlich zu erkennen. Weibchen sind nur schwer vom Männchen zu unterscheiden. Sie sind meist noch heller gefärbt und weniger kontrastreich gezeichnet. Jungvögel sind oberseits warm dunkelbraun gefleckt und unterseits beigebraun mit mittelbraunen Flecken. Sie ähneln in dieser Färbung Hausrotschwänzen.
Quellen und Links
- Collar, N. (2020). Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- Jahn A (2004): Warnsignale aus der Wüste. Spektrum. Spektrum.de, abgerufen am 30.1.2020
- siehe auch Literaturverzeichnis
Zitiervorschlag: