

Ursprünglich war die Amsel (Turdus merula) ein reiner Waldbewohner. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sie sich zum Kulturfolger entwickelt, der alle urbanen Räume besiedelt hat. Ihren Ursprung nahm die Verstädterung in Süddeutschland und der Schweiz. Sie ist bis heute in den östlichen europäischen Bereichen ihres Verbreitungsgebietes noch nicht abgeschlossen. Neben dem Buchfinken hat die Anpassungsfähigkeit die Amsel zu einer der häufigsten Brutvögel in Deutschland gemacht.
Usutu-Virus
Die Amsel ist ein Wirt des Usutu Virus. Diese Virenart ist das erste Mal 1959 in Südostafrika am Usutu-Fluss (Swasiland) isoliert und 1996 nach Europa eingeschleppt. Der Usutu-Virus ist für manche Vogelarten hochpathogen, neben der Amsel gilt das auch für den Bartkauz, Blaumeise, den Haussperling, die Kohlmeise, die Singdrossel und den Kleiber.
Äußerlich Symptome sind ein struppiges Kleingefieder, das sich bis zum völligen Fehlen der Feder im Kopf und Halsbereich auswirken kann. Die Vögel wirken apathisch und zeigen neurologische Ausfälle. Das Virus kann auf den Menschen übertragen werden. Die Infektion verläuft aber in der Regel ohne Symptome.
Steckbrief
Größe: 24 - 27 cm
Gewicht: 85 - 105 g
Verbreitung: Europa, Nordafrika, Kleinasien, eingeführt in Australien und Neuseeland.
Nahrung: Allesfresser, Wirbellose, Früchte auch kleine Wirbeltiere
Lebensraum: ursprünglich Wald und Waldränder, Kulturfolger, alle Biotoptypen mit Gehölzen
Zugverhalten: Standvogel, Zugvogel in den nordöstlichen Regionen
Brutzeit: März - September
Fortpflanzung: monogam, 2 - 6 Eier, bis zu drei Bruten pro Jahr. Brutdauer: 10 - 19 Tage, flügge nach 13 - 14 Tagen, unabhängig nach 20 Tage, Bruterfolg in urbanen Regionen gering (Katzen)
Höchstalter: 22 Jahre 3 Monate
Bestand: 7,4 - 8,9 Millionen Brutpaare in Deutschland. 38 - 55 Millionen in Europa,
Status: nicht gefährdet (Trend: stabil)
Brutvogel in Deutschland
Vogelstimmen
Die Amsel hat einen der schönsten Gesänge im Vogelreiche. Er ist leicht melancholische und sehr facettenreich. Über 100 verschiedene Gesangselemente sind bisher dokumentiert worden. Sehr markant sind auch die Warnrufe, vor allem, wenn sie von mehreren Vögeln vorgetragen werden.
Gesang
Warnruf
Verbreitung in Deutschland
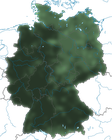
Die Amsel als ursprünglicher Waldvogel ist in ganz Deutschland verbreitet. Die Verstädterung setzt in Deutschland 1820 ein. Der Kulturfolger hat die höchste Siedlungsdichte in den strukturreichen Parks und Kleingärten der urbanen Bereiche. Eine geringere Dichte zeigt die deutsche Amselpopulation in den strukturschwachen Agrarlandschaften, vor allem in Ostdeutschland. Dünner besiedelt sind auch die höheren Lagen der Mittelgebirge und Alpen. Dort brütet sie erfolgreich bis in Höhen von 1600 m.
In Deutschland ist die Amsel, Brutvogel, Zugvogel und Wintergast. In Deutschland brütende Vögel sind in der Regel ganzjährig anwesend. Ringfunde zeigen jedoch, dass sich das Wanderungsgebiet in Deutschland beringter Vögel von den Färöer-Inseln und dem Norden Finnlands bis in das nördliche 'Afrika erstreckt. Das Zuggeschehen setzt im September ein, hat seinen Höhepunkt im Oktober und klingt im November ab. In kalten Wintern kann es zu Kältefluchten kommen. Ab Mitte Februar kehren zunächst die Männchen in die Brutreviere zurück. Die Beringung durchziehender Vögel auf Helgoland hat gezeigt, dass sich der Frühjahrszug der Amsel im Mittel um 11 Tage zwischen 1960 und 2008 verfrüht hat.
Bestandsentwicklung
Der Brutbestand der Amsel ist in Deutschland langfristig stabil, sie gilt in ihrem Bestand als nicht gefährdet. Jährliche Bestandsschwankungen lassen sich auf kalte Winter zurückführen. Mit der Urbanisierung hat die Amsel ihren Lebensraum deutlich erweitert. Der ehemalige Waldvogel zeigt sich enorm anpassungsfähig und ist so zu einem der häufigsten Brutvögel in ganz Deutschland geworden.
Vogel des Jahres
2010 wurde die Amsel in Kasachstan zum Vogel des Jahres gekürt.
Bildergalerie
Quellen und Links
- Collar N, Christie DA (2020). Eurasian Blackbird (Turdus merula), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- DDA (2024): Bestandsentwicklung, Verbreitung und jahreszeitliches Auftreten der Amsel in Deutschland. DDA, aufgerufen am 12.10.2024.
- Seite „Usutu-Virus“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Februar 2023, 13:50 UTC. URL; (Abgerufen: 27. Dezember 2023, 16:27 UTC)
- siehe auch Literaturvezeichnis
Zitiervorschlag:



