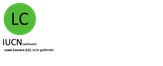Der Kanarengirlitz (Serinus canaria) ist die Stammart des domestizierten Kanarienvogels. Zwei Drittel der Population kommt auf den Kanarischen Inseln vor, der Rest auf Madeira und den Azoren. Auf Hawaii ist die Art eingeführt. Weit verbreitet ist die Art auf den Inseln El Hierro, La Gomera, La Palma, Teneriffa und Gran Canaria. Auf Teneriffa und Lanzarote kommt er nur sporadisch vor. Der Kanarengirlitz ist ein Standvogel, der allerdings im Winter in kleinen Schwärmen von dutzenden Vögeln auf der Nahrungssuche auch größere Entfernungen zurücklegen kann.
Kanarienvogel
Als Kanarienvogel ging die Zuchtform des Kanarengirlitz in die Geschichte ein. Kanarienvögel wurden im Bergbau als empfindliche Frühwarnsysteme eingesetzt, um giftige Gase wie Kohlenmonoxid und Sauerstoffmangel frühzeitig zu erkennen. Schon kleinste Konzentrationen führten bei ihnen rasch zu Symptomen wie Taumeln oder Verstummen, was den Bergleuten als lebensrettendes Warnsignal diente. Der schottische Physiologe John Scott Haldane empfahl Ende des 19. Jahrhunderts ihren Einsatz, da sie schneller reagierten als andere Tiere. Ihre besondere physiologische Empfindlichkeit machte sie sowohl im Regelbetrieb als auch bei Rettungseinsätzen unersetzlich. Zwischen 1911 und 1986 waren sie daher weltweit in vielen Bergwerken im Einsatz.
Steckbrief
Größe: 12,5 - 13,5 cm
Gewicht: 15- 20 g
Verbreitung: Azoren, Madeira und Kanarische Inseln. Eingeführt und fest etabliert auf Hawaii
Nahrung: hauptsächlich Samen, selten Knospen, Früchte, Insekten
Lebensraum: strukturreiche Wälder und halboffene Landschaft, auch Parks und Gärten bis über 1700 m
Zugverhalten: Standvogel, außerhalb der Brutzeit in Trupps unterwegs
Brutzeit: Januar - Juli
Fortpflanzung: monogam, 3 - 4 Eier, 2 - 3 Bruten pro Jahr. Brutdauer: 13 - 14 Tage, Nestlingszeit 15-16 Tage, unabhängig nach 5 Wochen
Höchstalter: im Käfig über 20, außerhalb bis 10 Jahre
Bestand: 80-90 Tausend Brutpaare
Status: nicht gefährdet (Trend: stabil)
In Deutschland beliebter Käfigvogel,
Stimme
Der Gesang besteht aus einer schnellen Abfolge melodischer, flötender und trillernder Töne, durchsetzt mit Zwitschern und Schnarrlauten, die häufig vom Wipfel oder einer offenen Singwarte aus vorgetragen werden – oft auch nach einem auffälligen Singflug. Als Rufe dienen hohe, feine Töne wie „sooee“ oder „swee“, kombiniert mit leichten Trillern oder Zwitscherfolgen, die meist im Flug erklingen. In Erregung oder bei Revierstreitigkeiten äußert der Vogel scharfe, wiederholte „zee“-Laute oder ein anhaltendes „didididi“.
Gesang
Rufe
Merkmale
Das Männchen zeigt im Brutkleid eine leuchtend gelbe Stirn, ein goldenes Überaugenband, grünlich-gelbes Oberkopfgefieder sowie gelbliche Unterseiten mit olivgrauem Anflug an Brust und Flanken. Das Weibchen ist insgesamt matter gefärbt, mit grauerem Kopf und stärkerer Strichelung auf Rücken und Flanken. Gelbe Farbtöne beschränken sich meist auf die Partie um Auge und Schnabel. Jungvögel sind überwiegend blassbraun mit dichter Strichelung und nur angedeutetem Gelb an Stirn und Kehle, das Schlichtkleid ist bei beiden Geschlechtern insgesamt blasser und weniger kontrastreich.
Quellen und Links
- Clement, P. (2020). Island Canary (Serinus canaria), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- siehe auch Literaturvezeichnis
Zitiervorschlag: