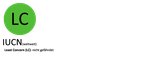Der Verbreitungsschwerpunkt des Berghänflings (Linaria flavirostris) liegt zwischen dem Kaukasus und den Steppen der Mongolei. Zu den europäischen Brutvorkommen in Großbritannien und Fennoskandinavien gibt es keine Verbindungen.
Auch die Überwinterungsgebiete überschneiden sich nicht. Das gilt auch für die beiden europäischen Unterarten. Die skandinavischen Berghänflinge überwintern von Südschweden bis Ungarn. Die britische Unterart hingegen zieht in niedrigere Lagen oder an die Küste Großbritanniens während der Wintermonate.
Steckbrief
Größe: 12-14 cm
Gewicht: 12-21 g
Verbreitung: Zentralasien und Tundra, baumfreie Bereiche im nördlichen Fennoskandinaviens und Großbritanniens.
Verbreitungsschwerpunkt in Europa: Schottland
Nahrung: Samen, Knospen, gelegentlich Insekten
Lebensraum: offene und feuchte montane und submontane Hochflächen und Tundren
Zugverhalten: Zug- und Standvogel
Brutzeit: April - August
Nest: am oder dicht über dem Boden, einzeln oder in kleinen Kolonien bis zu 15 Paare
Fortpflanzung: monogame Saisonehe, 5-6 Eier, 1 (2) Bruten pro Jahr, Brutdauer 12-13 Tage, flügge nach 10-13 Tagen
Höchstalter: 7,5 Jahre
Bestand: 164-756 Tausend Brutpaare in Europa; 3,3-15,1 Millionen Vögel weltweit
Status: nicht gefährdet, Trend: rückgängig, Europäische Population mehrt als 25 % in den vergangenen 12 Jahren
In Deutschland: Wintergast, primär im Bereich der Nordseeküste.
Stimme
Die Lautäußerungen des Berghänflings bestehen aus einem wirren Zwitschern mit metallischen und nasalen Tönen wie „zweeee“ oder „chweee“, die besonders häufig in fliegenden Schwärmen zu hören sind. Der Gesang ist eine Erweiterung dieser Rufe und enthält variable, trillernde und schnarrende Elemente, wirkt aber insgesamt weniger melodisch als beim Bluthänfling.
Gesang
Flugrufe
Verbreitung in Deutschland

In Deutschland ist der Berghänfling ein Durchzügler und Wintergast. In den Salzwiesen der Nordseeküste sowie in küstennahen Gebieten liegt sein Verbreitungsschwerpunkt in den Wintermonaten. Im Binnenland ist er vor allem in den ostdeutschen Bundesländern ein regelmäßiger Gast, während er in anderen Regionen Deutschlands nur ausnahmsweise beobachtet wird. Häufig treten Berghänflinge in größeren Schwärmen von mehreren Hundert Individuen auf. Bereits seit den 1970er Jahren ist ein Rückgang der Winterbestände zu verzeichnen. Ende der 1990er Jahre wurden diese noch auf bis zu 45.000 Vögel geschätzt, seither nehmen die Zahlen weiter ab. In Deutschland überwintern überwiegend Individuen aus den norwegischen, schwedischen und finnischen Populationen. Der Zuzug beginnt im Oktober, der Rückzug erfolgt im März. 1960 wurde zudem eine einmalige Brut auf Helgoland dokumentiert.
Schutzstatus
Der Berghänfling gilt weltweit als nicht gefährdet („Least Concern“) und ist in großen Teilen Europas, insbesondere in Norwegen, noch häufig anzutreffen. In Großbritannien und Irland hingegen ist die Brutpopulation seit den 1970er Jahren stark zurückgegangen – vorwiegend in Schottland und Nordengland –, was unter anderem auf Überweidung, Umwandlung von Lebensräumen, geänderte Mahdzeiten und klimatische Veränderungen zurückgeführt wird. Auch die Winterbestände, etwa in Südostengland und an der deutschen Nordseeküste, sind seit den 1980er Jahren deutlich gesunken, vermutlich infolge von Lebensraumverlust durch Küstenschutzmaßnahmen und verändertes Zugverhalten.
Merkmale
Mittelgroßer, kräftig gebauter Fink mit gestreiftem, braunem Gefieder, hellen Flügelbinden und kurzem, kräftigem Schnabel. Männchen im Brutkleid zeigen oft einen rosa bis hellroten Bürzel, während Weibchen und Jungvögel insgesamt unauffälliger braun und weniger kontrastreich gefärbt sind. Jungvögel ähneln den Weibchen, sind aber etwas wärmer braun getönt, deutlich gestreift an Brust und Flanken und besitzen blasse, beigefarbene Flügelsäume.
Quellen und Links
- Clement, P. (2020). Twite (Linaria flavirostris), version 1.0. In Birds of the World (del Hoyo J et al. Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- Dunning J et al. (2019). Population‐specific migratory strategies of Twite Linaria flavirostris in Western Europe. Ibis. 162. 10.1111/ibi.12791.
- siehe auch Literaturvezeichnis
Zitiervorschlag: