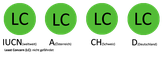Die Waldohreule (Asio otus) ist Deutschlands zweithäufigste Eulenart. Sie ist ein Vogel des Waldrandes, der im strukturreichen, offenen Grünland auf die Jagd geht. Bevorzugte Beute sind Wühlmäuse. Die im Flug erbeutet werden. Die Feldmaus kann einen Anteil von 90 % des Nahrungsspektrums der Waldohreule ausmachen. Der Bestand der Waldohreule ist deshalb abhängig von der Feldmaus-Gradation. In einem Zyklus von drei Jahren schwankt lokal der Bestand der Feldmaus. In Jahren mit einer Massenvermehrung können bis zu Tausend Feldmäuse je Hektar vorkommen.
Steckbrief
Größe: 35-40 cm
Gewicht: 220-370 g
Verbreitung: subtropische bis boreale Zone Eurasiens und Nordamerikas
Nahrung: Wühlmäuse, in Mitteleuropa hauptsächlich Feldmäuse
Lebensraum: Tageseinstand an Waldrändern, jagd in offener Landschaft mit hohem Anteil an Dauergrünland
Zugverhalten: in den kalten Klimazonen Zugvogel, sonst Standvogel
Brutzeit: Februar - April, abhängig von der Mäusepopulation
Nest: Baumbrüter vorwiegend in Krähennestern
Fortpflanzung: monogame Saisonehe, 3-5 (1-6) Eier, 1 Brut pro Jahr, Brutdauer 25-30 Tage, Ästlingsphase nach 20 Tagen, flügge nach 33-35 Tagen
Höchstalter: 27 Jahre und 9 Monate
Bestand: 25-41 Tausend Brutpaare in Deutschland, 304-776 Tausend in Europa, 2,0-5,5 Millionen Vögel weltweit
Status: nicht gefährdet (Trend: unbekannt)
In Deutschland Jahresvogel, Zugvogel und Wintergast, Brutvogel in ganz Deutschland
Stimme
Waldohreulen besitzen ein komplexes Lautrepertoire in der Brutzeit, sind jedoch außerhalb dieser Phase meist still. Männchen rufen nachts mit weit hörbaren, regelmäßig wiederholten „hoo“-Lauten zur Reviermarkierung und Partnerwerbung, während das Weibchen am Nest ein leises, nasales „shoo-oogh“ von sich gibt. Nestlinge betteln mit quietschenden Lauten, und bei Störung äußern sowohl Alt- als auch Jungvögel variable Alarmrufe wie „ooack“ oder ein schrilles „yaow“. Die Lautäußerungen erfolgen überwiegend nachts und hängen eng mit Brutpflege, Partnerbindung und Revierverhalten zusammen. Zusätzlich erzeugen Waldohreulen nicht-vokale Geräusche wie Schnabelschnappen und das typische „Flügelklatschen“, vor allem während der Balz.
Balzrufe Männchen
Flügelklatschen
Balzrufe Weibchen
Bettelrufe Jungvögel
Verbreitung in Deutschland

Die Waldohreule besiedelt in Deutschland eine Vielzahl halb offener Landschaften mit einem hohen Anteil an Gehölzen, Feldgehölzen und strukturreichen Offenlandbereichen. Die Art ist in Deutschland nahezu flächendeckend vertreten, wobei hohe Dichten besonders in Nordwestdeutschland und Teilen des Mittelgebirgsraums festgestellt wurden. In südlichen und östlichen Regionen wie dem Alpenvorland oder Teilen Thüringens ist sie stellenweise nur dünn verbreitet oder fehlt lokal. Unterschiede in der Verbreitung lassen sich teilweise durch Erfassungsdefizite erklären, teilweise auch durch tatsächliche Bestandsschwankungen.
In Deutschland ist die Waldohreule überwiegend ein Standvogel. Das Brutgebiet verlassen im Wesentlichen nur die Jungvögel. Das Zugverhalten Altvögel ist abhängig vom Nahrungsangebot im Winter. Im Oktober und November findet der Herbstzug statt, von März bis Mai der Frühjahreszug. Vögel der deutschen Population überwintern in Frankreich. Waldohreulen aus Skandinavien und dem Baltikum ziehen durch Deutschland oder überwintern hier.
Bestandsentwicklung
Langfristig wird der Bestand als stabil eingeschätzt. Die Population leider aber unter harten Wintern und Schwankungen in der Kleinsäugerpopulation. Seit den 1960er-Jahren wurden in mehreren Regionen Bestandsrückgänge festgestellt, insbesondere durch Lebensraumverlust infolge von Bebauung und landwirtschaftlicher Intensivierung. In jüngerer Zeit zeigen bundesweite Erhebungen jedoch eine stabile bis leicht zunehmende Bestandsentwicklung mit rund 25.000–41.000 Brutpaaren.
Schutzstatus
Die Waldohreule gilt in Deutschland derzeit als nicht gefährdet. Ihr Bestand wird als stabil eingeschätzt. In weiten Teilen Europas sind jedoch rückläufige Tendenzen zu beobachten. Hauptursachen dafür sind die Intensivierung der Landwirtschaft sowie der Rückgang der Wühlmauspopulationen, einer ihrer wichtigsten Nahrungsquellen. Hinzu kommen der Verlust offener Lebensräume, der Einsatz von Pestiziden und zunehmende Verkehrsopfer. In den USA wird die Art in einigen Regionen nach wie vor bejagt.
Merkmale
Mittelgroße Eule mit auffälligen Federohren sowie rundem Gesichtsschleier mit gelber oder oranger Iris. Ihr Gefieder ist oberseits schwarz, braun, grau, weiß und beige gemustert, die Unterseite ist hell mit dunkler Streifung. Männchen sind meist heller als Weibchen. Von der ähnlich aussehenden Sumpfohreule unterscheidet sie sich durch markantere Federohren und stärker gebänderte Unterseite, während der Uhu deutlich größer ist und weiter auseinanderstehende Ohrbüschel besitzt.
Quellen und Links
- Marks, J. S., D. L. Evans, and D. W. Holt (2020). Long-eared Owl (Asio otus), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- siehe auch Literaturverzeichnis
Zitiervorschlag: